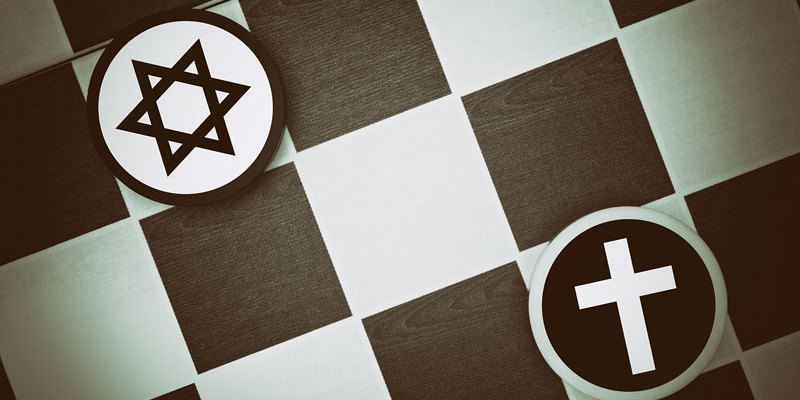
Neues Verhältnis Christen-Juden
Heute besteht weitgehende Wertschätzung des Judentums unter den Christen. Dem war lange nicht so. Damit sich diese Einstellung immer mehr verfestigt, begehen die christlichen Kirchen seit 18 Jahren den „Tag des Judentums“.
Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert es ganz deutlich: Glaube, Erwählung und Berufung der Kirche haben in Israel ihren Ursprung und Anfang. Bis zu dieser Erklärung ist es ein langer Weg. Im Juni 1960 kommt es zu einer Begegnung zwischen Papst Johannes XXIII. und dem 83-jährigen französischen Historiker Jules Isaac, der selbst Opfer der Judenverfolgung unter dem Vichy-Régime gewesen ist und seine Frau und seine Kinder im Holocaust verloren hat. Ihn bewegt der große Wunsch nach Beseitigung des Antisemitismus und nach Freundschaft zwischen Juden und Christen. Bereits 1959 legt er Papst Pius XII. Vorschläge für eine Neuorientierung der jüdisch-christlichen Beziehung vor, die das gemeinsame Erbe von Juden und Christen, die jüdische Abstammung Jesu, Maria, der Apostel und der ersten Märtyrer betont.
Bleibende Wurzel im Judentum
Isaac unterbreitet nun Johannes XXIII. das Anliegen einer neuen christlichen Verhältnisbestimmung zum Judentum und bittet ihn um eine offizielle Erklärung, worauf der Papst Kardinal Augustin Bea, den Vorsitzenden des Sekretariats für die Einheit der Christen, mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Dokuments beauftragt. Bea ist deutscher Jesuit, Professor für Altes Testament und Direktor des Bibelinstituts in Rom. Dieser Auftrag wird das Leben von Augustin Bea von diesem Moment an prägen. Eine Unterkommission leistet den größten Beitrag des Dokuments, unter deren Mitgliedern sind auch zwei Konvertiten: Prälat Johannes Oesterreicher, der noch als Jude in Graz katholische Theologie zu studieren begonnen hatte, und Gregory Baum, ein deutsch-kanadischer Theologe und Augustiner. Im Mittelpunkt stehen die Anerkennung der Wurzeln der Kirche im Judentum, die Widerlegung der Vorstellung, dass das jüdische ein von Gott verfluchtes Volk sei, die Verkündigung der eschatologischen Dimension der Versöhnung zwischen Juden und Christen sowie die Verurteilung des Antisemitismus.
Nostra Aetate
Am 28. Oktober 1965 wird die Endvorlage von „Nostra Aetate“ von der Konzilssession mit großer Mehrheit angenommen. Damit wird das Verhältnis zwischen Christen und Juden neu definiert: Glaube, Erwählung und Berufung der Kirche haben in Israel ihren Ursprung und Anfang. Israel ist die bleibende Wurzel der Kirche aus Juden und Heiden. Alle Christen sind dem Glauben nach als Kinder Abrahams in die Berufung des Patriarchen eingeschlossen. Die Kirche ist nicht nur durch den Alten Bund und das Alte Testament, sondern auch durch die jüdische Abstammung Jesu, Marias, der Apostel und der meisten der ersten Jünger mit dem jüdischen Volk verbunden. Auf Grund des gemeinsamen geistlichen Erbes ruft das Konzil auf, das brüderliche Gespräch und die gegenseitige Kenntnis und Achtung zu fördern. Entschieden verurteilt die Kirche alle Formen von Rassismus und Antisemitismus. Was uns heute wie selbstverständlich erscheint, ist damals alles andere als selbstverständlich. Bei vielen Christen herrscht die Vorstellung vor, das Volk Israel sei „verflucht“, „verworfen“ oder in seiner Gesamtheit für den Tod Christi verantwortlich und deswegen zu einem „herumstreunenden“ Leben verdammt. Bis heute halten sich diese Vorurteile und begegnen wir solchen Irrtümern. Das gilt es zurechtzurücken, nicht zuletzt durch unsere Arbeit.
Bernhard Dobrowsky